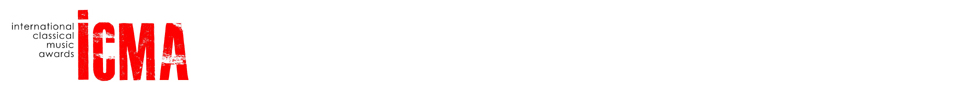Der Pianist Evgeni Koroliov wurde mit dem ICMA 2015 für seine Aufnahmen von Franz Schuberts Sonaten D. 894 & D. 959 bei Tacet ausgezeichnet. Isabel Roth, Mario Vogt und Martin Hoffmeister haben das folgende Gespräch mit ihm geführt. Redigiert wurde es von Remy Franck.
Evgeni Koroliov, 1949 in Moskau geboren, lebt seit 1978 in Hamburg und ist Professor an der Hochschule für Musik und Theater. Er selbst war Student des legendären Tchaikovsky-Konservatoriums. Zu seinen Lehrern zählten Heinrich Neuhaus, Maria Judina, Lev Oborin und Lev Naumov. Er war Preisträger der Bach-Wettbewerbe in Leipzig und Toronto und gewann 1977 den ‘Grand Prix’ beim Clara-Haskil-Wettbewerb.
Herr Koroliov, wie sind Sie eigentlich zum Klavier gekommen? Kommen Sie aus einer Musikerfamilie?
Nein, das nicht! Aber als ich klein war, war es in Russland üblich, die Kinder musikalisch unterrichten zu lassen. Und mein Vater konnte es sich leisten, für meine zwei älteren Brüder ein kleines Klavier zu kaufen. Beide haben angefangen Klavier zu spielen, es aber dann relativ schnell aufgegeben. Und weil ich Melodien vom Gehör her ‘klimpern’ konnte, oder auch wollte, natürlich, hat man mich auch unterrichten lassen. Und so bin ich Pianist geworden.
Hatten Sie in Ihrer Kindheit ein besonderes Erlebnis mit Musik, das Sie dazu motiviert hat, zu denken: Ja, das möchte ich beruflich machen, das ist mein Leben?
Ja, ganz besonders haben mich die Stücke von Bach, Mozart oder Schubert berührt, auch kleine Stücke, die ich schon spielen konnte. Und vor allem habe ich sehr, sehr früh angefangen, zu komponieren, und das war für mich interessant und motivierend. Ich habe eigentlich nie gedacht, Pianist zu werden, eher Komponist. Aber es kam eben anders.
Gab es in Ihrer Kindheit ein ganz besonderes Konzert von einem der großen Pianisten oder Dirigenten, das Sie als großes Erlebnis wahrgenommen haben?
Ich erinnere mich sehr gut an ein Konzert mit dem bekannten französischen Dirigenten Charles Münch. Einer, der für mich immer so etwas wie Licht war, war der Geiger Oleg Kagan. Und sehr wichtig war ein Treffen mit Glenn Gould im Kleinen Saal des Tchaikovsky-Konservatoriums. Er spielte drei Stücke aus der ‘Kunst der Fuge’, und das mich sehr geprägt.
Sie haben ja bereits als 17-jähriger Bachs ‘Wohltemperiertes Klavier’ im Konzert gespielt. Das war wahrscheinlich in jener Zeit schon ungewöhnlich. Wie kamen Sie auf diese Idee?
Ich fühlte mich von dieser Musik immer sehr angezogen, und dieses Erlebnis mit drei Stücken aus der ‘Kunst der Fuge’ hat mich so sehr inspiriert, dass ich mit großer Liebe und Interesse Bach gespielt habe. Das ist mir auch nicht sehr schwer gefallen. Das ‘Wohltemperierte Klavier’ zu spielen, war einfach ein Vergnügen. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht, auch später nicht, ob das etwas Gewinnendes für das Publikum ist oder nicht.
War das eher ein Expertenpublikum, oder waren es auch Leute, die regulär Klavierabende besuchten?
Damals war das Moskauer Publikum schon sehr, sehr gut. Es gab eine große Zahl von Musikliebhabern, und es war kein Problem, damals Bach zu spielen…
Dabei spielte das Barockrepertoire ja eigentlich in Russland keine große Rolle, und es gab nur wenige Pianisten, die diese Werke im Konzert spielten. Svjatoslav Richter und Marija Judina haben ja quasi eine Ausnahmeposition eingenommen.
Genau! Bei Maria Judina habe ich auch einige private Stunden gehabt. Sie war verliebt in Bach und hat eigentlich ganz gut, wenn auch unkonventionell gespielt. Aber damals war ja noch keine Rede von historischer Aufführungspraxis. Und Bach auf dem Flügel ist sowieso nicht mehr authentisch, das ist ganz klar.
War das für Sie jemals eine Überlegung, Bach auch auf einem Cembalo oder einem Clavichord zu spielen?
Ja! Das Cembalo habe ich jedoch nie so ganz liebgewonnen, im Gegensatz zum Clavichord. Das ist mein Lieblingsinstrument, aber es ist ungeeignet für die Konzerttätigkeit, weil es ein sehr, sehr leises Instrument ist.
Welche Rolle spielt denn ein Instrument für den Pianisten? Können Sie verstehen, dass András Schiff oder Krystian Zimerman ihren Steinway mit auf Reisen nehmen?
Ja, das ist schon sehr gut, wenn man es sich leisten kann, vor allem logistisch. Ich bin jedoch ein bisschen Fatalist und spiele auch manchmal auf nicht gerade phantastischen Instrumenten, weil ich sowieso nicht denke, dass ich im Konzert etwas Perfektes schaffe.
Wie gehen Sie denn damit um?
Ich versuche natürlich, so gut wie möglich aus meiner Erfahrung und aus dem Gehör heraus die Nachteile des Instrumentes wettzumachen. Hauptsache ist, dass man sich nicht sozusagen in Gedanken zerstückelt: Jetzt muss ich das machen und das. Am Ende ist für mich die innere Einstellung zur Musik entscheidend.
Gehen wir mal von idealen Bedingungen aus. Was ist Ihr Klangideal auf dem großen Konzertflügel?
Ein guter Flügel singt … Doch bleiben wir realistisch: Ich bin schon zufrieden, wenn die zweite Oktave gut klingt. Früher, so vor 50 Jahren, hatte ich Instrumente, wo auch die dritte Oktave noch sang.
Sie unterrichten seit vielen Jahre in Hamburg – hat sich etwas verändert in der Studentenschaft? Haben die Schüler heute eine andere Auffassung von dem, was es heißt, Pianist werden zu wollen, als die von früher?
Schwer zu sagen! Alles ist so unterschiedlich von Mensch zu Mensch, Ich glaube, dass die Musiker der heutigen Generation viel praktischer denken müssen, denn sie müssen ihr schweres Schicksal irgendwie meistern, ja? Sie müssen das erreichen, was sie machen wollen, zum Beispiel Konzerte spielen. Und das ist wirklich nicht leicht in diesen Zeiten! Dazu braucht es viel Energie.
Was geben Sie Ihren Studenten mit auf den Weg?
Ich möchte, dass sie begreifen, dass es etwas Schöneres als Musik nicht gibt auf der Welt. Sie sollen, glaube ich, glücklich sein, dass sie sich damit beschäftigen können, egal in welcher Position, ob als Konzertpianist oder als Lehrer an einer kleinen Musikschule.
Bevorzugen Sie für Ihre Aufnahmen den Konzertsaal oder das Studio, im Hinblick auf die künstlerischen Resultate?
Also, ich bin eigentlich nach einem Konzert oder einer Aufnahme immer etwas unzufrieden. Insofern macht das für mich keinen Unterschied.

Evgeni Koroliov erhält den ICMA-Award aus den Händen von Jurymitglied Denis Bocharov
(c) ICMA-Aydin Ramazanoglu
Was bedeutet es für Sie, mit dem ‘International Classical Music Award’ ausgezeichnet worden zu sein?
Das ist sehr angenehm, das ehrt mich, aber eigentlich bin ich jemand, der für Ehrungen keinen gut entwickelten Sinn hat. Dafür kann ich aber viel leichter Kritik einstecken.
Welchen außermusikalischen Passionen gehen Sie nach?
Passionen? Also Leidenschaften? Also vor allem doch alte Musik.
Nein, außermusikalische!
Ach, außermusikalische…. Oh ja, da sind viele: Malerei, Architektur, Poesie, Literatur. Früher war es noch das Schachspiel, für das mir heute sowohl die Zeit als auch die richtigen Partner fehlen. Aber ich kaufe immer noch Schachzeitungen und lese sie, das ist das letzte, was geblieben ist.
Letzte Frage: Welches ist Ihre Prognose für die Klassische Musik für die kommenden zehn Jahre?
Für die kommenden zehn Jahre prognostiziere ich keine sehr leuchtende Zukunft. Ich glaube, es wird eher in Richtung von Veräußerlichung weitergehen. Es kommen ganz, ganz schwere Jahre, und das hat nichts mit unserer Musik zu tun, sondern mit der ganzen Entwicklung der Kultur, die wir nicht stoppen können. Meine Idee ist, dass ich und einige andere Musiker, die ähnlich denken wie ich, sozusagen eine ‘Katakomben-Kultur’ aufbauen müssen, um die Zeit irgendwie zu überbrücken, so wie das früher irische Mönche gemacht haben, in dunklen Jahrhunderten, um die Kultur nicht ganz zugrunde gehen zu lassen.